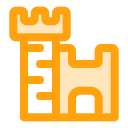Gräben, Zwinger und Gelände: Die Landschaft als Waffe
Breite Gräben, oft mit Wasser gespeist, verhinderten das Heranbringen von Belagerungsmaschinen. Trockengräben zerschnitten den Angriffsraum und machten Minenarbeiten riskanter. Selbst wenn Feinde Brücken bauten, blieben sie exponiert. In Caerphilly schuf das gestaffelte Wassersystem eine träge, aber tödliche Barriere.
Gräben, Zwinger und Gelände: Die Landschaft als Waffe
Der Zwinger zwischen Außen- und Innenmauer zwang Angreifer durch schmale Korridore. Von beiden Seiten beschossen, hatten Belagerer kaum Deckung. Historische Berichte schildern, wie Pfeile, Bolzen und Steine dort zu einem Hagel wurden, der jeden unbedachten Vorstoß ruinierte.
Gräben, Zwinger und Gelände: Die Landschaft als Waffe
Hügelsporne, Flussmäander und Felsklippen gaben Burgen natürliche Stärke. Eine Burg wie Marksburg nutzt den Rheinabhang als riesige Schräge. Wege mussten in Serpentinen ansteigen, was Vorrücken verlangsamte und Verteidigern Zeit gab, Kräfte zu bündeln, Signale zu übermitteln und Gegenstöße zu planen.
Gräben, Zwinger und Gelände: Die Landschaft als Waffe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.